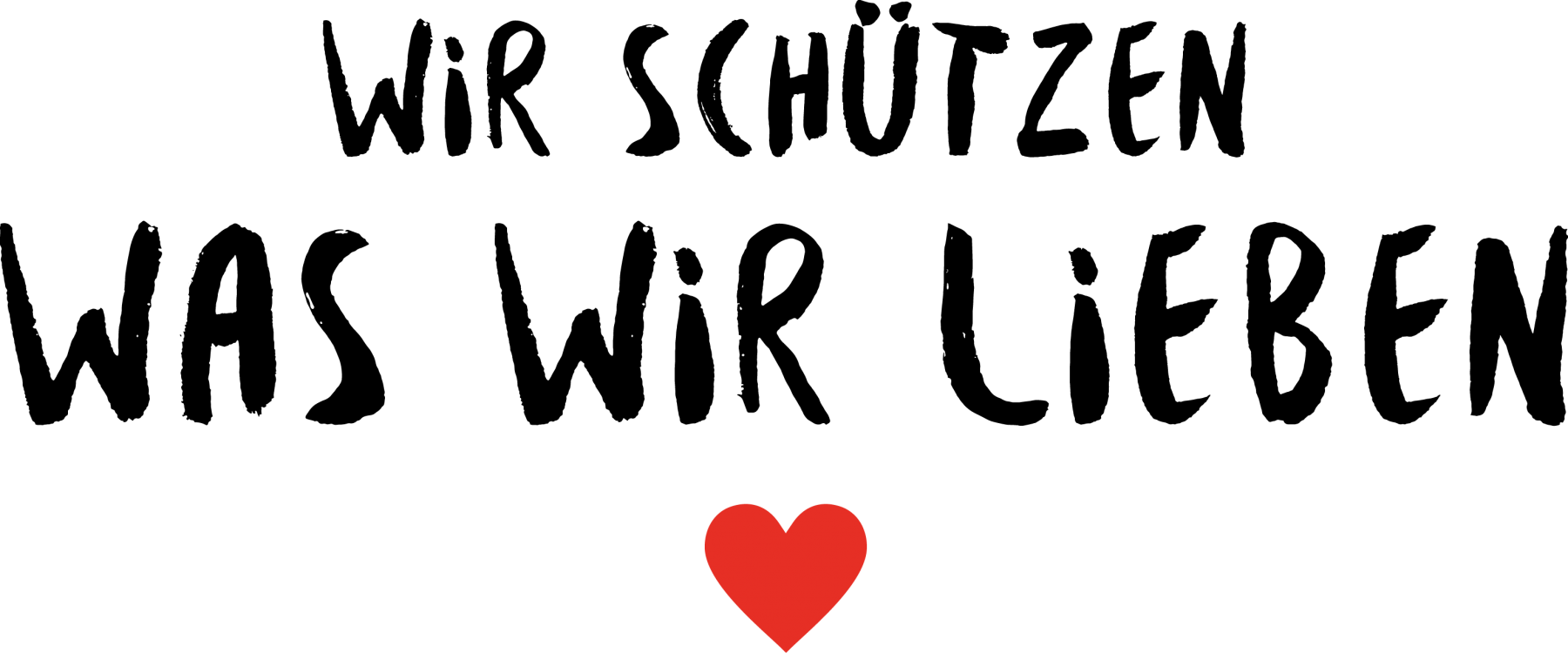Dem Klima verbunden
Die Bauernfamilien arbeiten in und mit der Natur. Deshalb spüren sie den Klimawandel besonders gut. In den letzten Jahren waren das beispielsweise sehr trockene Sommer und generell mehr Wetterextreme wie Stürme, Hagel oder Starkniederschläge. Gleichzeitig ist die Landwirtschaft für 13.2 Prozent der Schweizer Emissionen von klimarelevanten Gasen verantwortlich.
Landwirte sind vom Klimawandel direkt betroffen
Negative Auswirkungen überwiegen langfristig
Die Landwirtschaft kann teilweise vom Klimawandel profitieren: Dank wärmeren Temperaturen und längeren Vegetationszeiten können neue Kulturen wie Soja, Süsskartoffeln oder Reis in der Schweiz Fuss fassen. Gesamthaft überwiegen aber die negativen Effekte. So steigt der Bewässerungsbedarf: Nicht nur bei Gemüse und Obst, sondern auch Kartoffeln, Zuckerrüben u.ä. Mildere Winter sind zudem schlecht für das Wintergetreide, das auf ausreichend lange Kälteperioden angewiesen ist. Schädlinge können sich ebenfalls besser entwickeln. Vermehrte Engpässe in der Raufutterversorgung in trockenen Sommern sind zu erwarten. Die Zunahme von Spätfrösten oder Hagel erhöht das Produktionsrisiko.
Heute werden vor allem Gemüse, Obst und Beeren sowie in den Südtälern auch Wiesen bewässert.
Wie die Bauern sich dem Klimawandel anpassen (müssen)
Aktuell reicht der Regen auf 95 Prozent des Landwirtschaftslandes, damit die Kulturen gedeihen. Nur gerade knapp fünf Prozent der Flächen bewässern die Bauern zusätzlich. Vor allem im Mittelland in Gebieten mit intensiver Landwirtschaft gibt es aber zunehmend Nutzungskonflikte und Engpässe. Toleranz und Resistenz gegenüber Hitze und Trockenheit spielen in der Wahl der Kultur und Sorte deshalb vermehrt eine Rolle. Auch Bodenschutzmassnahmen sind bedeutend. Ein gesunder, humusreicher Boden hat ein besseres Wasserrückhaltevermögen und trocknet weniger schnell aus. Die erwarteten höheren Durchschnittstemperaturen bringen auch im Pflanzenschutz neue Herausforderungen. Besonders Schadinsekten profitieren von der Klimaerwärmung. Das schlägt sich in einer höheren Vermehrungsrate und neuen Arten aus dem Süden nieder. Ein anderes Thema sind Versicherungen gegen Trockenheit und andere Wetterextreme. Solche sind aktuell aber teuer und lohnen sich nur für besonders wertschöpfungsstarke Kulturen.
Anteil der Landwirtschaft bei den Treibhausgas-Emissionen und Aufteilung innerhalb der Landwirtschaft (Quelle BAFU, 2019)
Methan, CO2 und Lachgas
Die Landwirtschaft hat an den gesamtschweizerischen Treibhausgasemissionen aktuell einen Anteil von 13,2 Prozent. Fast die Hälfte der landwirtschaftlichen Emissionen ist Methan, das Grasfresser wie Kühe in Form von Fürzen und Rülpser ausstossen. Dazu kommt Lachgas, das sich bei der Hofdüngerlagerung bildet oder aus Böden entweicht. CO2 stammt aus dem Treibstoffverbrauch und gelangt ebenfalls aus den Böden in die Luft. Über die Hälfte der klimaschädlichen Emissionen aus dem Bereich Ernährung fallen allerdings im Ausland an. Das liegt am stetig wachsenden pro-Kopf-Import an Lebensmitteln. Seit 1990 nahm dieser um über 40 Prozent zu.
Landwirtschaft übernimmt Verantwortung
Gerade weil sie selber vom Klimawandel stark betroffen ist, will die Schweizer Landwirtschaft ihren Teil zu einer besseren Klimabilanz beitragen. Sie befindet sich dabei auf gutem Weg: So senkte sie ihre Treibhausgasemissionen seit 1990 um über elf Prozent. Jene aus dem Treibstoffverbrauch gingen sogar um über zwanzig Prozent zurück. Der natürliche biologische Prozess, welche die Kühe furzen und rülpsen lässt, ist aber nicht beliebig veränderbar. Aber es gibt durchaus Massnahmen mit Potenzial: Höhere Lebenstagesleistungen bei Milch- und Mutterkühen verbessern die Bilanz pro Tier. Futterzusätze wie Leinsamen können die Bildung von Methan reduzieren. In Biogasanlagen kann mittels Fermentierung von Mist und Gülle das Methan genutzt werden, um Strom zu produzieren.
Agroforstsysteme können ein möglicher Ansatz für die Zukunft sein.
CO2 in Böden speichern
Im Pflanzenbau lassen sich mit nitrifikationshemmenden Düngern oder präziseren Gaben die Lachgasemissionen senken. Gewisses Potenzial bergen auch Anbausysteme, die durch Humusaufbau CO2 im Boden speichern. Als mögliche neue Ansätze bieten sich beispielsweise Agroforstsysteme an. Dabei kombiniert man den Anbau von Gehölz- und Kulturpflanzen innerhalb einer Parzelle. Auch permanente Bodenbedeckung durch Gründüngungen fördert den Humusaufbau und verhindert den Verlust durch Erosion. Eine reduzierte Bodenbearbeitung sowie das Einarbeiten von Pflanzenresten und Zwischenbegrünungen in die Böden helfen ebenfalls.
Biogasanlagen machen aus Mist und Gülle Ökostrom und wertvollen Kompost.
Viel Aktivität
Es gibt zahlreiche Initiativen für Klimaschutzmassnahmen in der Landwirtschaft. Als Energie- und Klimaschutzagentur der Schweizer Landwirtschaft fördert Agro-CleanTech eine ressourcen- und klimafreundliche Landwirtschaft und ist Anlauf- und Auskunftsstelle rund um Fragen zu Energieeffizienz, erneuerbaren Energien oder Klimaschutz. Ein weiterer wichtiger Akteur ist «Ökostrom Schweiz», der als Branchenverband der landwirtschaftlichen Biogasbetreiber in der Schweiz fungiert. Zudem haben diverse Produzentenorganisationen wie aaremilch und IP-Suisse Programme ins Leben gerufen, bei denen Betriebe freiwillig mitmachen können und sich verpflichten, mittelfristig ihre Treibhausgasemissionen zu senken.
Die landwirtschaftliche Produktion ist geprägt von der Nachfrage. Die Anzahl Tiere wegen deren Methanausstoss zu reduzieren, bringt dem Klima nichts, wenn das Fleisch stattdessen importiert wird. Die Konsumenten haben es mit in der Hand: Lokale, saisonale Produkte kaufen und Food Waste vermeiden!